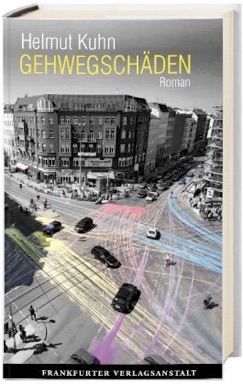Helmut Kuhn: Gehwegschäden, Frankfurter Verlagsanstalt, 439 Seiten
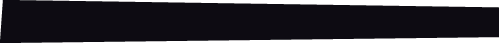
Paris hat sehr viele Romane hervorgerbracht, anhand derer man einen Stadtplan seiner kreativen Viertel und Cafés anfertigen könnte über die letzten 100 Jahre - von Hemingway bis Patrick Modiano. Die Namen der Boulevards haben eine Bedeutung für sich und vermitteln dem Paris-liebenden Leser das Gefühl einer Realität, in die man eintauchen oder sie auch nur nachvollziehend abschreiten könnte. Vor allem aber erhält man den Eindruck, dass die Stadt DA ist und auf eigenartige Weise ein eigenes Leben hat, neben den Figuren, die sie literarisch bevölkern.
Für Berlin gibt es solche Bücher auch, wenn auch meist mit einem ganz anderen Ton, rauer, weniger interessiert an „der Stadt“ als lebendes Etwas, als an den Leuten und ihren Krisen und Einzelheiten. Selten hat man das Gefühl, die Stadt färbt auf die Leute ab, greift als „Charakter“ in die Handlung ein. Mal abgesehen von Emil und die Detektive oder Herr Lehmann, die man sich in keiner anderen Stadt vorstellen könnte, könnten viele der als Berlin- Romane vermarkteten Bücher, auch in jeder anderen Großstadt spielen.
Das wohl berühmteste, das nur da spielen kann, wo es spielt, wird auf die eine oder andere Weise auch in GEHWEGSCHÄDEN zitiert: Berlin Alexanderplatz. Die Hauptfigur in GEHWEGSCHÄDEN heißt Thomas Frantz, er treibt sich am Hackeschen Markt, Rosenthaler und Alexander Platz herum, macht irgendwas mit Medien (wenn auch nicht im Buch) säuft, raucht, driftet und boxt und erinnert so in Ort und Name an den Franz Biberkopf aus Berlin Alexanderplatz. Da enden dann aber auch die Analogien.
Wie in Döblins Jahrhundertwerk ist GEHWEGSCHÄDEN zu Beginn stark fragmentiert, einzelne Zeilen teilen die Seite, es gibt Kurzzusammenfassungen als Überschriften, man berlinert oder österreichert und der Leser folgt einem eigenartigen Helden durch den Moloch Berlin. Der besteht in diesem Buch allerdings aus einem Sammelsurium von Miniaturen und Portraits, ist mehr Reporage mit künstlerischen Freiheiten, als Roman. Man sagt, einen Berg könne man nur aus der Entfernung ganz sehen. Kuhn jedenfalls ist zu dicht dran. Und: Er ist zu sehr Journalist. Das wirkt sich positiv auf sein Auge und sein Ohr aus, auch auf den teilweise tollen Flow beim Lesen und man spürt, wie er an der Sprache, an einzelnen Formulierungen gefeilt hat. Doch wo Döblin die Stadt durch seine literarische Form als waberndes Ganzes fassbar machte, ist GEHWEGSCHÄDEN eher ein 400 Seiten Dossier aus der ZEIT oder eine sehrsehr lange Seite 3 aus der Süddeutschen Zeitung. Reportage, Portrait, dicht dran und gut geschrieben, aber ohne, ja, künstlerischen „Mehrwert“, ohne den Auftrieb eines Romans, der einen aus dem „So ist das“ herausheben kann als Leser damit wir irgendwann, und sei es nur für kurz, das Ganze erkennen, zumindest erahnen.
Das Berlin, das Kuhn beschreibt, scheint Kulisse für geschwätzige, irritierte, selbstgefällig und wenig bemitleidenswerte Gescheiterte und großkotzige Möchtegerns zu sein. Portraits sind das, wie man sie in launigen Zeitschriftenartikeln oder Reportagen lesen kann, die aus den neuen Trendvierteln, von eigenartigen Veranstaltungen oder Szenetreffen berichten und zum Ziel haben den Provinzleser (alle außerhalb Berlins) schaudern zu lassen ob der Verruchtheit, Planosigkeit, Unangepasstheit und Langschläferei in der Hauptstadt.
Manchmal erscheint einem das Buch wie ein aufgeblasener Marco Polo Reiseführer „Hippes Berlin“, denn sämtlich alle Orte, die heute angesagt sind (jedenfalls für den Mainstream Touristen) tauchen irgendwann auf + ein paar Geheimtips.
Doch all das ist sehr uneinheitlich: Mal Miniaturen von Personen in einem Mietshaus, die dann nie wieder auftauchen, gefolgt von Sex&Drugs in einer teilnehmenden Beobachtung wie im STERN aus dem Berghain mit Darkroom, Rudelbumsen, schmerbäuchigen Wichsern und nymphomanischen Drogenmädchen. Dann folgen wir dem Helden zur Geliebten und beim Langeweilen mit seiner Freundin. Dann ein Artikel über die Architekturgeschichte eines NS, dann SED Hauses in Mitte, aus dem nun ein Nobelclub für die Mover&Shaker der Hauptstadt geworden ist. Dann werden wir Zeuge eines Kunstprojektes, dann schauen wir uns einen alten Tresorraum in einem jetzt Nobelhotel an, dann wieder ein bisschen Schachbox Philosophie, ein paar absurde unzusammenhängende Szenen aus der Welt des Marktes: ein Inkasso Szene, eine Kundenbeschwerde, eine Reportage von den Kabbalisten in Berlin, ein Einkauf im Gentrifizierungszentrum, eine Hasstirade auf die neuen Mütter und Altväter am Prenzlauer Berg, ein bischen Social Slumming in Neukölln mit ein paar Säufern beim Wetten, eine weitere Hasstirade auf die „Prekarianer“ der digitalen Boheme, eine Reportage von einer Pecha Kucha Nacht und eine Begegnung mit Sasha Lobo (der hier aus künstlerischen Gründen offenbar anders heißt aber auch ungefragt einen Vortrag hält über seine Arbeit.)
Und plötzlich, auf den letzten 80 Seiten wird dieses seltsame Buch mit dem schönen Umschlag eine scheiternde Liebesgeschichte, geradlinig erzählt. Als hätten die 350 erratischen Seiten zuvor nur als Einleitung zu einer echten Schlusshandlung gedient. Als wäre das Buch so noch nicht konfus und zerfleddert genug, setzt Kuhn in ergrauter postmoderner Manier an Anfang und Ende noch einen namenlosen Ich-Erzähler, der uns Lesern sagt: Ja, den hab ich mal gesehen, den Thomas Frantz. Den gibt es. Aber, kann aber auch sein, dass ich Euch nur Scheiss erzähle und all das ausgedacht ist. Wer das überfrachtet, prätentiös, verkünstelt und seltsam leer findet, hat Recht. Wer wissen will, was der typische Berlinbewohner mit Geld und Beruf in den Medien so als cool und hip und seins empfindet, kann hier was lernen.
Es bleibt am Ende der Eindruck, dass hier ein fähiger Journalist eine gut lesbare, mit klugen und auch witzigen Absätzen bestückte, aber letztlich uneinheitliche, disparate, Langreportage ohne Thema und Zentrum (denn um Berlin geht es nicht!) geschrieben hat, die er Roman nennt, auch wenn sie aus vielen Miniaturen plus künstlerische Freiheiten und literarischen Firlefanz (Alltagstexte, Lautsprache, Einschübe, fragmentiertes Erzählen) besteht. Komischerweise scheint Döblins Buch auch heute noch mehr über Berlin zu erzählen, als dieser scheinbar so gegenwärtige Roman.