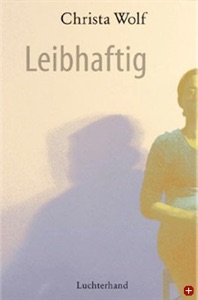Christa Wolf: Leibhaftig, Luchterhand, 184 Seiten
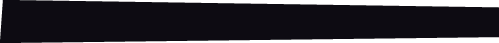
Eine Erzählung nennt der Verlag es. Es ist aber eher eine zähe Meditation über das Kranksein. Wenig ergiebig für den Leser, es sei denn, er möchte Christa Wolf auf ihren Reisen durch Ich, das auch mal „sie“ ist, wo dann aus Du, „er“ wird, folgen. Verwirrt? Richtig. Soll man wohl.
Wechselnde Erzählperspektiven gehören zum Repertoire des modernen Romanciers, aber hier werden im Satz die Seiten gewechselt, was wohl die Entfremdung der Erzählerin im Hinblick auf ihren Körper (und Staat?) zeigen soll, mir jedoch recht verkünstelt und aufgesetzt erschien. Und nicht zweckdienlich. Ebenso wie die Tatsache, dass seitenlang über ein Wort in all seinen Komposita philosophiert wird (zeitlos, zeitnah, zeitig, Zeitkomplex...), während man doch lieber mal etwas erfahren würde, über diesen Mensch der dort liegt, aber nicht leidet, sondern vor allem labert. Innerlich versteht sich, die Dialoge dieses Buches passen auf eine Seite.
„Die Krankheit als Metapher für Unerträglichkeiten des Systems ist ein bekanntes Sujet im Werk Christa Wolfs. Mal waren es - kaum verschlüsselt - ihre eigene Hüftoperation und ihre Erfahrungen mit der Psychatrie der DDR in "Hierzulande Andernorts", 1999, mal eine unheilbare Krebskrankheit in "Nachdenken über Christa T." von 1986, die Marcel Reich-Ranicki mit dem Satz "Christa T. stirbt an der Leukämie, aber sie leidet an der DDR"
Das schrieb die FAZ damals. Also eine Tradition ihres Schreibens. Der Lesefreude hilft es nicht weiter. Und ist die Metapher nicht nur zu naheliegend und darüber hinaus im Jahr 2002 auch nicht mehr nötig, um ihren Text zu tarnen? Die DDR ist tot, Christa Wolf eine Autorin in Deutschland. Was will sie uns also erzählen?
Es geht in „Leibhaftig“ um nichts als die allmähliche Genesung der Autorin/Erzählerin von einer Infektion in einem Krankenhaus mit dem entsprechenden Personal und einem gesichtslos bleibenden Partner. Ebenso gesichtslos wie die Figur selbst, das Land und das Personal. Es gibt eigenartige Rückblicke auf Personen aus der Vergangenheit, einen Urban, Professor für irgendwas, der sich offenbar nicht korrekt verhalten oder eigenartige oder wechselnde Ansichten pflegte - was einem aber herzlich egal sein ist. Rückblicke in den Krieg, ein jüdischer Arzt, eine Tante, die diesen heiratete, auch als es gefährlich wurde wegen der Nazis und ein bisschen Erinnerungen an die Studentenzeit sind eingeflochten. Es gibt eine Diskrepanz zwischen sprachlichem Anspruch und inhaltlicher Leere in diesem Text. Durchaus literarisch ist er, ja, anspruchsvoll gar, aber leblos und ereignislos und irgendwie nutzlos. Vielleicht eine Generationen Frage, aber Günther Grass Texte hinterlassen einen ähnlichen Eindruck.
Einige schöne Passagen, dicht und sprachlich rund, gibt es, und ganz am Ende auch ein Satz, der bleibt: Der Schmerz des Verlustes ist die Summe der Hoffnungen, die man mal hatte. Und das war‘s dann. Patient gesund, Leser schläft.