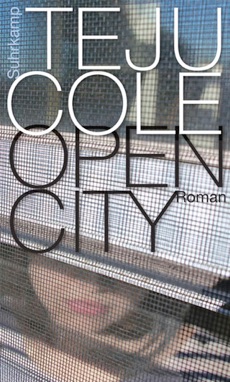Teju Cole: Open City, suhrkamp 334 Seiten
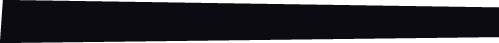
Ein bisserl viel des Lobs ist es im Nachhinein. „Ein Buch über das Grundgefühl New Yorks“ sollte es sein, der „moderne Flaneur“ im Geiste von Benjamin und anderen, DER Stadtroman des 21. Jahrhunderts usw. Dazu ist Cole als Autor so eine Art Obama der Literatur; Weltbürger (kommt aus Nigeria, studierte in USA, lebt dort als Autor und Psychiater, reist und schaut, geprägt aber auch von Old Europe über die Eltern). Alles richtig, aber trotz der sprachlich schönen Momente dann und wann, den scharfsichtigen Blicken auf die heterogene, Multikulti (ganz unromantisch!) Stadt, den Einblicken in „being a black man“ im salat bowl der Kulturen - es fehlt dem Buch an einer Geschichte, selbst wenn man essayhaft, vergeistigte, mit Unter-, Nebensträngen und Rückblicken versehene Bücher mag. Im Grunde läuft ein junger schwarzer Psychiater ohne erkennbaren Grund, leicht melancholisch aber wach durch New York (und eine Weile auch Brüssel) und denkt so nach: Über sich, seine Familie, das Leben als Schwarzer, seinen Beruf, seine Herkunft und die US Gesellschaft in Form von New York. Und das war‘s dann auch.
Dabei trifft er nicht viele Leute und es gibt auch nur sehr wenig Dialog. Es passiert auch nichts mit ihm im engeren Sinn, außer dass er im letzten Kapitel von „Brüdern“ vermöbelt und ausgeraubt wird und einer alten Jugendsünde im wahrsten Sinne des Wortes begegnet. Beider Ereignisse haben haben aber KEINEN Einfluss auf den Fortgang der Erzählung und finden ohnehin dramaturgisch seltsam auf den letzten Seiten statt, bevor fast am Schluss das Erlebnis eines Mahler Konzerts geschildert wird, bevor der Autor über die Tatsache räsoniert, dass an der Freiheitsstatue (!) Vögel (die freiesten von allen!) sterben. ENDE. Als wäre diese Tatsache die Synopsis des Romans. Das wirkt nicht nur für die 330 Seiten zuvor ungewohnt plakativ und platt, sondern wird ihnen auch nicht gerecht.
Der Erzähler ist ein Klassikliebhaber, einsam, kaum Freunde, die wir so bezeichnen würden, und ein Spaziergänger, der die Stadt auf der Suche nach allerhöchstens sich selbst durchstreift. Er meditiert über Dinge im Museum, über Begegnungen und Orte und bemüht sich wie in dem Film 25th hour von Spike Lee oder Büchern wie Fegefeuer der Eitelkeiten ein Bild der Stadt zu zeichnen. Orte lösen Erinnerungen aus (manchmal arg bemüht konstruiert) und so erfahren wir auch ein wenig über diesen Mann - der mich als Typ nie wirklich interessiert. Mal ist er mal schockiert über ein Hitler Bild, dann trifft er ohne erkennbaren Grund (und auch ohne Einfluss auf den Fortgang der Ereignisse oder die Emotionen oder irgendetwas) seinen altern Professor, der im Sterben liegt, dann steht er an einem Mahnmal eines Sklavenfriedhofs und denkt über diese Menschen nach oder erzählt von dem Nicht-Verhältnis zu seiner Mutter, dessen Gründe im Dunkeln bleiben. Hin und wieder eröffnen sich durch Coles Beschreibungen die verschiedenen historischen und kulturellen Ebenen dieser Stadt, ihre Herkunft und hier Heute - aber diese Schichtungen zeichnen ja nicht nur NY aus, sondern so ziemlich jede Stadt dieser Welt: Viel vorher, viele Einzelschicksale, die allermeisten verloren und vergessen. Irgendwo auf diesem ewigen Zeitstrahl ein einsamer Wolf (der Autor), der darüber nachdenkt wie sowas von sowas kommt...
Man könnte an den Invisible Man von Ellison denken, aber Cole bemüht sich jede Form von schwarzer Emanzipation zu vermeiden, ja fremdelt mit den Urformen schwarzer Kultur in den USA wie Jazz. Er ist selbst ein Fremder und bleibt einer. Seine Freundinnen spielen keine Rolle und auch nicht seine Freunde (die man ein einziges Mal trifft als Leser, die dann aber nur in einen Exkurs über die Geschichte seiner Disziplin (Psychologie) als Stichwortgeber zu dienen). Seine Familie wird erwähnt (sein Vater fast gar nicht), seine Mutter, seine Oma - alle bleiben wie Papercuts flach und fern.
Und dann ist das Buch zu Ende. In Erinnerung bleibt nichts. Kein besonderes Gefühl, jedenfalls keine Sehnsucht oder Neugier auf die Stadt, die er erzählen will, auch keine kleine Geschichte in der Großen, die einen über die Komplexität oder Absurdität dieser Welt nachdenken lässt, auch nicht über all die erwähnten Bücher und Musikstücke, die sehr ausgestellt erscheinen und nur dazu dienen, einen Charakter zu formen, der trotzdem aus Papier bleibt. Auf seltsame Weise ist Open City trotzdem keine enttäuschende Leseerfahrung, aber eine, die irritierende Leere schafft, ein Loch erzeugt, in dem auch die klugen kleinen Erkenntnisse und scharfen Beobachtungen des Stadtlebens verschwinden, so dass nur ein schöner Buchumschlag bleibt, wenn man das Buch schließt und zurück ins Regal schiebt.