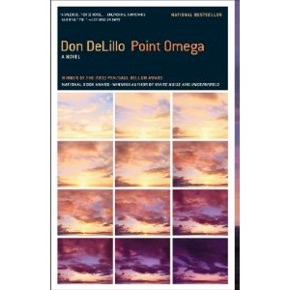Don DeLillo: Point Omega, Scribner, 117 Seiten
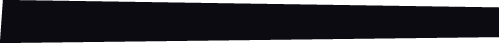
Es beginnt als eine Meditation über eine Video Arbeit des Künstlers Douglas Gordon: 24 hours Psycho. Ein namenloser Mann geht jeden Tag in das MOMA in N.Y. und schaut sich an, wie der berühmte Hitchkock Film auf 24 Stunden gestreckt, mit zwei Bildern pro Sekunde, ohne Ton abläuft. Und er macht sich so seine Gedanken zu Zeit, Bild, Raum und Mensch. Man kann DeLillo förmlich sehen, wie er selbst in dem Raum steht, vielleicht stundenlang und seinen Gedanken freien Lauf lässt, sich Notizen macht und durch die Interpretation dieser Arbeit, der Frage nach Wirklichkeit im Film, Lebenszeit und Filmzeit, Beobachtung von Details und flüchtiger Zeit über sich selbst nachdenkt.
Der Mittlere Teil des Buches setzt das Thema Zeit und Raum fort und die Art, wie wir Leben, abhängig vom Raum und wie wir ihn denken: Ein Filmemacher besucht einen ehemaligen Berater der Regierung in einer Hütte irgendwo in der Wüste, um ihn von einem Projekt zu überzeugen. Er möchte einen Film über ihn drehen, nur der Mann vor einer Wand, wie er über seine Zeit im Pentagon während des Irakkriegs erzählt, wo er arbeitete um neue Perspektiven auf dein Umgang und die Strategie und die Maschinerie des Krieges den Männern und Frauen an den Entscheider-Positionen beizubringen. „Den Haiku des Krieges finden“, beschreibt er seine Aufgabe, also den Leuten zeigen, dass das, was sie sehen, das ist was passiert. Klingt einfach, ist aber unmöglich. Womit dann auch die Verbindung zu dem Kunstfilm am Anfang geschaffen wäre, den die beiden Männer offenbar auch kurz zusammen besuchten und von dem Unbekannten dabei beobachtet wurden. Natürlich in totaler Unkenntnis des gegenseitigen Wer und Warum.
Doch der Mann will keinen Film über sich machen lassen. Er redet nicht viel und wenn, dann meist über das Leben in Angesicht des Universums und der Unendlichkeit. Gespräche zu denen die Wüste, die Antithese zu Leben und Zeitbegriff in der Stadt einlädt.
Klug und selbstbewusst und ein wenig irre ist er Alte. Der Filmemacher bleibt trotzdem und die beiden verbringen viele wortlose Abende auf der Veranda trinkend, mitten in der Wüste, den Sonnenuntergang anstarrend und ebensolche Tage der Hitze und Schwere im Schatten wartend. Auf den richtigen Gedanken, den richtigen Moment. Für was? Das bleibt unklar.
Dann taucht die Tochter des alten Mannes auf, ebenfalls eine eigenartige Frau. Wir erfahren, dass sie Anrufe von einem Unbekannten bekam und die Mutter sie zu ihrem Vater in die Wüste schickte. Ansonsten bleibt diese Frau vor allem Projektionsfläche der Gedanken das jungen Mannes, dort draußen, mitten im Nichts. Alle möglichen Gedanken: Sex, Verständnis und Erklärung. Ohne Worte meist, denn auch sie redet kaum. Und dann verschwindet sie.
Die beiden Männer alarmieren die Polizei und nach einer Zeit der inneren Monologe, der ewigen Blicke auf Wüste und Sonne und Sterne, Gesprächen über den Gehalt des Lebens und den Sinn des Tuns und Denkens, beginnt nun schieres Handeln. Suchaktionen, Telefonate mit der Außenwelt Es werden kaum noch Gedanken geschildert, sondern die Männer handeln, sie suchen und warten. Doch sie bleibt verschwunden, ist verloren gegangen und es wird keine Antwort geben. Alle Theorien und schönen Worte, alle Pläne, die Konzepte die Welt zu sehen und zu erklären, all das erscheint angesichts dieses Verlusts und Mysteriums plötzlich lächerlich. Die Tochter verschwindet in der Wüste: zurück bleibt nicht ein Intellektueller, ein kluger Mann, ein Stratege und Querdenker, sondern ein trauernder, gebrochener Mensch.
Das Ende diese unglaublich komprimierten, dichten Buchs ist wieder in der Ausstellung im MOMA und bei der Begegnung zwischen dem Mann vom Anfang des Buchs und einer Frau, die, wie wir ahnen, die verschwundene Tochter ist. Sie sprechen kurz über den Film und er wünscht sich diese Dinge, die Männer allein in Ausstellungen im Dunkeln einer Projektion sich eben wünschen, wenn eine hübsche Frau neben sie tritt und sie anspricht. Und dann endet die Projektion und das Buch und all die Beziehungen auch. Grandios.
DeLillo scheint nach seinem Monumentalwerk Underworld nur noch die kleine Form zu wollen. In dem misslungenen Falling Man oder nun in Point Omega, das wieder seine ganze Klasse und Brillanz zeigt.
Mit Recht wird er immer wieder für den Nobelpreis ins Gespräch gebracht, denn er schreibt klug und gelassen, dicht und doch berührend über unsere Leben und ihre Verbindung zu all den anderen Leben, die Frage von Wahrnehmung, Wahrheit, Tod und Sinn, die Geschichte und ihre Bruchlinien, dass man immer das Gefühl hat, kurz davor zu stehen, etwas Fundamentales endlich zu verstehen. Kurz davor. Und indem wir das spüren, auch die Grenze ahnen, zwischen dem was ist und was wir denken was ist, erfüllt Literatur ihren Zweck.