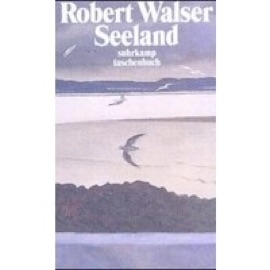Robert Walser: Seeland, suhrkamp, 220 Seiten
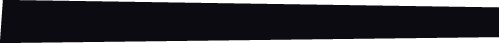
Sofort steht man mitten im Adjektivgewitter: Keck, zart, umschmeichelnd, freudiges Leuchten, verwundert umherblicken, liebes Rauschen oder Rieseln eines Bächleins, entzückendes Geplauder, es schäumt ungebärdig, zaubervolle Schlucht, aufmerksames Lauschen, lustiges Gelage, drollige Antiquitäten, fraghafter ernsthafter Halbmond usw usf...So geht das Seite auf Seite bei den ersten drei Geschichten voller Naturbeschreibungen und handlungslosem Geschehen.
Vielleicht diese Art Literatur, die in ihrer Rokokohaftigkeit und Süßlichkeit das Lesegefühl wie mit Blattgold überzieht, heute, wo der lakonische Ton dominiert, vollkommen antiquiert. Die ersten dreißig Seiten dachte ich noch Robert Walser mache einen Witz, seine ziselierte Sprache sei ein Stilmittel, um das schreckliche Ende des beschriebenen Künstlers, den Knall, um so lauter und härter zu machen. Aber nein. Das IST der Stil. Die Geschichten von Walser über scheiternde Künstler, Väter oder ausgedehnte Spaziergänge ähneln kindlichen Wimmelbildern ohne Zentrum und erkennbar zusammenhängendes Geschehen - außer der Stimme des Erzählers selbst. Das ist Mozart-Literatur plus doppelten Zuckerguss und zartbesaitete Puderzucker Seelenspiegelung. Man erstickt in der Verspieltheit und kleinteiligen Wegesrandwelt, die Walser uns beschreibt und uns durch die Augen des Wanderers teilhaben lässt. Totale Innerlichkeit, eine malerische, detailverliebte Verkopfung, die keinen Raum lässt, selbst etwas zu sehen, das der Autor nicht sah oder uns sehen lassen wollte. Irgendwann dachte ich: lese ich noch einmal von „lieben“ Landfrauen oder einem „süßen, lieben Weg“, muss ich kotzen.
Eine Erzählung ist ein Brief, und für diese Form von Literatur die richtige Form. Die strenge Ich-Form, der Monolog und die totale Subjektivität. Die pastellfarbenen Beschreibungen von menschelnden Szenen oder seelenerfüllten Landschaften wechseln über zu Stilleben, wo die Menschen kleine Wesen in einem Tal oder an einem Berg, auf einem Feld sind. Reflexion über Gewesenes und das Schreiben und die Kunst und die Zartheit der Wahrnehmung an sich sind absatzweise eingeschoben.
Walser setzt auch - ganz modern - einen Brechtschen Verfremdungseffekt ein, indem er sich in direkter Rede an den Leser wendet. Aber das ist auch schon alles an Konzessionen an die Gegenwart.
Umwege und Verästelungen in alle Richtungen des Erzählens, ein kindliches Abschweifen von dem ohnehin nur schwer erkennbaren Erzählzentrum, Natur und allzu menschliches, Beschreibungen - daraus besteht das Buch, das zeitgleich mit dem Ulysses von Joyce entstand, DEM Werk der Moderne, das wohl die wenigsten, mich eingeschlossen, gelesen haben, dessen Idee aber viel veränderte. Doch auch seines mühsamen Stils, seiner Detailwut ist sich Walser zu meinem Erstaunen bewusst gewesen: denn er schreibt: „Hierüber soll so umständlich wie möglich Bericht erstattet werden.“ Ja, man muss annehmen, er wollte diese Geschichten so schreiben.
Walser als Skeptiker der Moderne in jener Zeit und damit Romanen wie Berlin Alexanderplatz, die ebenfalls in den 20er Jahren entstanden, scheint sich künstlerisch hier in den Impressionismus zu flüchten und die totale Innerlichkeit des Äußeren, also der Welt um ihn, wie ein Schild vor sich zu tragen. Das Buch hat durchaus seine Momente und Sätze voller Poesie, aber man muss durchhalten, um unter dem Sprachpuderzucker nicht zu ersticken, weil man weiß: eine Rose riecht schön, tausende Rosen stinken.
Dass der Mann die letzen 30 Jahre seines Lebens in einer Klapse verbracht hat, überrascht nicht, weil das manische Schauen und Beschreiben sich auch hier schon andeutet. Kaum vorstellbar wie Walser fern der Natur seines Sees in der schweizer Heimat, in einer Großstadt mit all ihrem Lärm und den Widersprüchen nicht wahnsinnig geworden wäre. Ich wäre es durch ihn und dieses Buch fast geworden und griff als Gegengift zu einem Hemingway.