
Lorrie Moore: Was man von einigen Leuten nicht behaupten kann, Berlin Verlag 327 Seiten
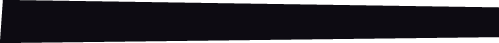
Die Kurzgeschichten die ohne Frage toll geschrieben sind, genau beobachtet, mit frischen, unverbrauchten Bildern und brillanten Formulierungen, gut gebaut und zuverlässig - aber alles irgendwie ohne Gefühle zu wecken in mir. Ein Lesen ohne die Nähe zu den Figuren zu spüren oder die Notwendigkeit der Distanzierung von Ihnen aufkommen zu lassen, oder Ärger, Empörung, Mitgefühl.
Bei fast allen dieser thematisch aber auch stilistisch sehr unterschiedlichen Stories hat man das Gefühl, hier kann eine Autorin ganz, ganz viel und will das auch zeigen. Und auch klingt nicht richtig, weil nach „gewollt“ oder „gestelzt“ - das sind die Geschichten nicht, nur dass sie seltsam kalt sind - von Ausnahmen wie „Willig“ oder „Agnes von Iowa“, die von Frauen erzählen, die mehr wollen, als sie sind und das auch wissen, wodurch ein gewisses Gefühl von Drama entsteht.
Wir Leser warten bei einigen der Figuren auf ihr Scheitern oder Durchkommen, beides unangenehm so neutral zu begleiten. Überhaupt wird das Buch von Frauen bevölkert, die aus Kleinstädten kommen und auf die eine oder andere Weise nicht am richtigen Ort sind - sei es die Ehe, die Stadt, der Beruf. Dann eine Geschichte von einem Blinden und seinem Freund auf einer Überlandtour, die auch wieder nett und skurril ist, aber im Grunde wurschteln die so vor sich hin und als Leser wurschtelt man sich durch den Text. Der nach viel zu langer Zeit in diesem Fall, irgendwann endet.
Es gibt einen Immobilienmissgriff, lästige Mitbewohner von Mardern über Teenager im Dachboden und eine Ehe, die aus Schweigen besteht, dazu ein ein bizarrer Einbrecher, der den Leuten Lieder abnötigt, bevor er sie beraubt, bis er erschossen wird, was wir einmal aus seiner und aus der der Schützin erzählt bekommen. Auch wieder alles gut gesetzt und nett und doch... ja belanglos.
Diese Stories begründeten den Ruhm von Lorrie Moore in Deutschland. Sie liefert weiterhin regelmässig Geschichten an den New Yorker, lehrt ansonsten Englisch, schreibt über Bücher und Kunst. Wer die Geschichten von Alice Munro kennt, wird diese zwar auch mögen (auch wenn sie fast alle in der Stadt spielen und nicht wie bei Munro auf dem Land), aber er wird auch einen Unterschied bemerken in Klasse und Wärme und Tiefe - und der „Bedeutsamkeit“, falls es das gibt. Bedeutsam heißt nicht spannend, politisch oder aktuell Bedeutsam ist ein Gefühl, dass die Geschichte etwas über das Leben erzählt, das eines anderen, das aber mich irgendwie betrifft. Egal wie banal die Handlung auch zu sein scheint oder weit weg von meinem Leben. Eine tiefere Wahrheit gewissermaßen, die Kunst verströmt. Und genau das Gefühl will sich bei der Lektüre nicht einstellen, bei jeder der Geschichten gelingt es mir aufs neue nicht.
Und so: keine vertane Zeit aber erneuter Beweis, dass es „gute Geschichten“ gibt und „gute Geschichten, die für einen gemacht sind“. Die einen geben wie ein Raum, das Gefühl richtig zu sein. Und die anderen berühren einen nicht, auch wenn dieser die gleichen Maße haben mag, wie der andere und nach allgemeinen Kriterien auch als „gut und schön“ gilt.


