
Anthony Doerr: All das Licht, das wir nicht sehen, C.H.Beck, 528 Seiten
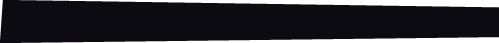
Es war ein bizarres Erlebnis, wie sich die Figuren aus zwei sehr unterschiedlichen Romanen, kurz hintereinander gelesen, plötzlich aufeinander bezogen und scheinbar in Dialog traten mit ihren Geschichten. Während ich die eine Geschichte las, schien die andere schon gelesene in dieser fiktiven Welt parallel stattzufinden: Walter aus „Im Frühling sterben“ von Ralf Rothmann rast mit seinem Motorrad 1945 durch Ungarn auf Suche nach dem Grab seines Vaters, während die blinde Marie-Laure aus „Alles Licht, das wir nicht sehen“ in Saint-Malo auf die Invasion der Alliierten wartet und ihr deutsches Gegenüber Werner die Sender von Partisanen aufspürt.
Und doch sind die beiden Bücher sehr unterschiedlich und aus unterschiedlichen Gründen toll: Wo Rothmann auf knapp 250 Seiten aus einem jungen Deutschen mit Träumen einen schweigsamen Bergmann der Nachkriegszeit macht, erzählt Doerr über 530 Seiten von einem Mädchen, das ohne Vater im Haus des exzentrischen Onkel und der Haushälterin in der Resistance die Besatzung zu überstehen versucht. Und gleichzeitig vom naturtalentierten Radio-Techniker Werner, Waise aus dem Ruhrgebiet, dann Napola-Eliteschüler und mit maximaler Anpassungsfähigkeit und Gefallsucht ausgestattet, der am Ende zwangsrekrutiert wird für die Wehrmacht und Piratensender der Partisanen aufspürt. Und von der Jagd eines deutschen Offiziers nach einem besonderen, sehr wertvollen Diamanten, der in Händen von Marie-Laures Vater war und in Hitlers Museum sein soll. Das alles von Mitte der 30er Jahre bis in die Invasionszeit erzählt - und dann in zwei Epilogen noch bis in die Gegenwart - auch um uns Nach- und Spätgeborenen den Zugriff auf die Vergangenheit zu ermöglichen, die ja einem Diktum von Faulkner folgend, nie tot und schon gar nicht vergangen ist.
Anthony Doerrs mit dem Pulizter Preis ausgezeichneter Roman ist eine Lektüre wie gemacht für den Urlaub: viele Seiten, sehr flüssig zu lesen, am Ende mit einem Sog, der selbst die schönste Umgebung und Kindergeschrei vergessen lässt, weil Intensität, Melancholie so stark sind und zugleich das wortlos machenden Gefühl, dass hier der große Bogen von der Geschichte und dem Einzelnen Menschen in ihr, von der Gegenwart der Vergangenheit in der Gegenwart, vom Schmerz über die Endlichkeit bis zum Wissen um die Bedeutsamkeit des eigenen Lebens, alles zusammen erzählt wird.
Vielleicht ist der Roman literarisch (also für die Sprachkünstler und Avantgardisten) nicht gerade ein Fixstern, aber trotzdem ein grandioses Buch: Unkonventionell erzählt, verlässt es sich in guter angloamerikanischer Tradition auf des Erzählen ohne dabei bloß „plot-getrieben“ oder schon auf Filmrechteverkauf mit vielen Dialogen und reine Handlungsbeschreibung geschrieben zu sein. Stattdessen: Dutzende meist kurze Kapitel, oft Werners und Marie-Laures Welt gegeneinander schneidend, innere Monologe, Exkurse und eine im kommerziellen Film kaum umsetzbare Verschachtelung und Schnitttechnik der Szenen, Orte und Personen. So nutzt Doerr gerade die Kraft der Literatur. Er baut seine Welt wie eine Kathedrale an zwei Seiten auf, mit Werners und Marie Laures Geschichte als Säulen, bevor er mit der Begegnung der beiden, auf die die Geschichte zutreibt sowie der Jagd nach dem Diamanten der Kathedrale ein Dach gibt. Die beiden gelungenen Figuren (vielleicht ist Werner ein bisschen zu passiv und Marie-Laure etwas zu idealisiert französisch feminin selbstbewusst) teilen dann nur um einen sehr kurzen, doch entscheidenden Moment im Roman und in ihrem Leben. Es wird eine Begegnung, die alles ändert, aber wie ein Sandkorn im Sturm des Krieges erscheint.
Die große Fähigkeit dieses Buchs ist es, eine Welt zu schaffen, die zugleich bitter wie märchenhaft, erzählverliebt und episch, wie auch dem Realismus verpflichtet ist, die sich auf Handlung verlässt, aber Gedanken, Exkurse und Stimmungen elegant miterzählt. Es ist eine Geschichte wie das Leben, das immer weiter, immer weiter geht - eben auch dann noch, als einer der Protagonisten stirbt, dann noch einer verschwindet, dann die ganze Epoche untergeht. Und irgendwie auch noch, wenn man die letzte Seite gelesen hat.
Zugleich: Nochmal lesen werde ich das Buch erstmal nicht. Dafür ging die Spannung dann doch vom „Was wird passieren?“ aus. Aber die Stimmung, mit der ich am Tisch vor unserer Urlaubsresidenz die letzte Seite las, nach einem langen Strandtag, die Kinder lachend um mich tobend - die werd nicht vergessen: Einen Moment lang waren die Sinne geschärft und offen für das, worum es geht - für die Schönheit der Vergänglichkeit.
Christian Caravante
